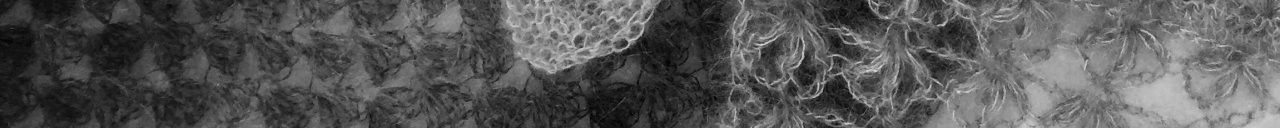Dunkle Wolken über Dresden
Der Name Pegida wird sofort mit politisch rechts assoziiert (man muss nur mal googeln). Kein Wunder, betrachtet man den Vorsitzenden, der nicht erst einmal im Verdacht der Volksverhetzung stand. Außerdem steht der Name als Abkürzung von Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, ein nicht eben linker Zungenschlag. Jedoch…
…macht man es sich zu einfach, wenn man Pegida-AnhängerInnen pauschal und ausschließlich für Neonazis hält. Zu dieser Erkenntnis kommt, wer sich Sabine Michels Dokumentarfilm „Montags in Dresden“ ansieht.
Darin werden drei Pegida-Leute portraitiert, die Michel über ein Jahr lang begleitet hat. Eine davon ist eine junge Frau, die ihren autistischen Sohn mit Hingabe allein erzieht. Sie steckt voller Ängste, mögen sie auch irrational sein. So hortet sie Lebensmittel für den Fall eines Angriffs durch z.B. russische Truppen. Sie ist auch überzeugt davon, seit der Zuwanderungswelle 2015 in Dresden abends nicht mehr allein joggen gehen zu können, ohne belästigt zu werden. Gegen derlei Befürchtungen geht sie montags auf die Straße. Sie fühlt sich akzeptiert bei Pegida. Und abends liest sie im Koran, weil sie wissen will, wie die Flüchtlinge aus Syrien ticken.
Was ist ein Dokumentarfilm?
Sabine Michel, selbst geboren und aufgewachsen in Dresden, mittlerweile weit herumgekommen, führt ihre Protagonistinnen und Protagonisten nicht vor. Sie widerspricht ihnen im Film nicht, fragt aber durchaus nach, lässt sie Widersprüchlichkeiten selbst darstellen und geht auf Abstand. Sie bewertet die Menschen nicht, sie will sie verstehen oder zumindest kennenlernen.
Für diesen Ansatz ist sie heftig kritisiert worden. Sie hätte Stellung beziehen müssen, lautet ein oft wiederholter Vorwurf. Michel jedoch hat eine klare Vorstellung davon, was Dokumentarfilm zu sein hat. Im lesenswerten Interview mit Annett Gröschner hat sie klargestellt:
„Mein Dokumentarfilmethos begibt sich immer auf Augenhöhe. Ich verweigere Manipulation und achte meine Protagonisten. Nur so kann ich etwas erfahren, was Bestand hat.“
Michel diskutierte am vergangenen Samstag mit Gästen der „Großen Kiesau-Literaturnacht“, die unter dem Motto „Wendezeiten“ stand. Die Regisseurin argumentierte überzeugend reflektiert und forderte einen Diskurs über Pegida, der „andere Ansichten auch mal aushält“.
Auf die Frage, warum denn so viele Dresdner die wieder erblühte Stadt nicht zu würdigen wüssten, antwortete Michel: „Weil sie nicht ihnen gehört.“
Schlüsselszene
Der Film zeigt in einer Schlüsselszene, wie Miteinander-Reden scheitern kann. Genau daran, findet die Regisseurin, müsse gearbeitet werden.
Nachdem es bei der Uraufführung des Films in Leipzig Proteste gab, erklärten die Veranstalter, der Film fordere dazu auf, sich eine eigene Meinung zum Geschehen zu bilden. Gröschner kommentiert treffend:
„Mich machte diese Stellungnahme ratlos. War das nicht genau das, was einen guten Dokumentarfilm ausmachte? Und war es nicht die Errungenschaft der ‚friedlichen Revolution’, nicht mehr bevormundet zu werden, die Klappe aufzumachen, nicht alles ideologisch einordnen zu müssen, etwas stehen zu lassen, ohne es sofort zu kommentieren, andere Meinungen auszuhalten, weil doch unsere anderen Meinungen nie ausgehalten worden war, ohne zu strafen oder zu tadeln?“
Es scheint, dass Frauen wie Sabine Michel und Annett Gröschner viel darüber zu sagen haben, was bei der Wiedervereinigung schief gelaufen ist. Ihnen zuzuhören sollte das Mindeste sein.
Foto: pixabay