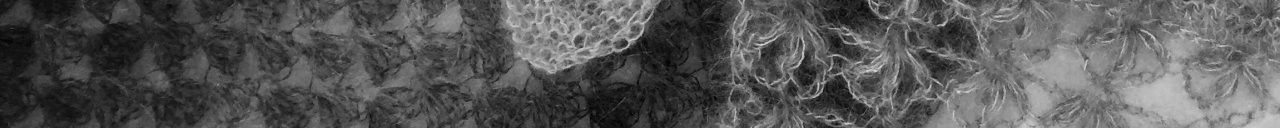Als ich letzte Woche im Hamburger Hauptbahnhof auf den Zug wartete, fiel mein Blick auf den Metallpfosten neben mir. „Why don’t germans smile?“ hatte jemand eingeritzt.
Sofort spürte ich die Power der Suggestivfrage: prüfte mein Gewissen, ob ich etwa auf Grund von Mundwinkelfaulheit meinen Mitmenschen die Laune vermieste. Scheu blickte ich an allen Vorübergehenden vorbei – sicher ist sicher! – auf dass ich sie nicht infizierte.
Doch halt! Weder bin ich bekannt für meine Leichenbittermiene noch sehe ich Jabba the Hutt ähnlich. Wie würde mich der Spruchritzer einordnen? Wie ist er oder sie wohl selbst zuwege?
Der erste Film, der sich vor meine Augen pflanzte, hatte einen lässigen Rasta-belockten Jamaikaner zu bieten, der Reggae summend über den Bahnsteig schlenderte und mit aller Welt gut Freund war – falsch: gern wäre, was aber die mies gelaunten Deutschen leider vereiteln. Traurig lässt er sich auf der Bank nieder und hobelt nachdenklich die Buchstaben in den Pfosten.
Der nächste Anwärter ist eine Anwärterin: eine knackige Cheerleaderin mit perfekt blondgefärbter Löwenmähne, bunter Püscheldeko und Knopfdruckgrinsen. Sie merkt gar nicht, dass ihr der junge Student gegenüber schüchtern zulächelt, solange er nicht kurz vorm Zähnefletschen ist. Schmollend zieht sie einen pinkfarbenen Mehrzweckstift aus der Tasche und ritzt mit adretten Lettern ihre Botschaft in den Pfosten.
Schon folgt der glutäugige Südländer, hartes halbes Leben hinter sich, endlich im Land der gebratenen Tauben angekommen – und wo bleibt sie, hä? Die Willkommenskultur? Ist er etwa zu schlecht dafür? Steht ein bisschen Freundlichkeit nur Syrern zu? Ungehobelt, diese Schweinefresser! Da hilft grad nur – phomb! – der Griff zum Ritzmesser und sich ein bisschen Luft verschaffen.
Ich muss lachen: nur Klischees, die mir da einfallen. Doch why not? Passt schon. Die niemals smilenden Germans gehören schließlich in die gleiche Kategorie.